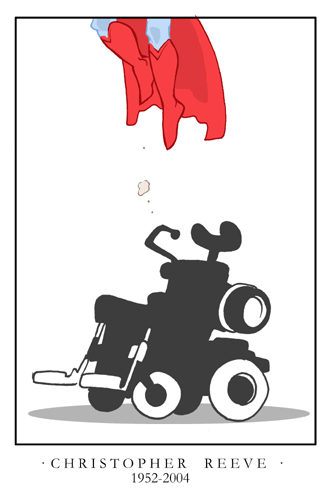Ist zwar schon ein Weilchen her, als den angeschaut habe, aber Kill Bill war ja richtig öde. Frauen und Mister-Miyagi-Karate sind mir sowieso ganz suspekt. Irgendwie hatte Tarantino mit Pulp Fiction einen Glückstreffer gelandet. Der Rest seiner Regiearbeiten wurde immer tröger und deren Erfolgt lebte im Endeffekt nur noch vom Hype. Dann doch lieber Jackie Chan, der ja derzeit auf Kabel 1 präsent ist.
Wieso ich gerade jetzt darauf komme?
In der SZ steht, »dass Quentin Tarantino seinen nächsten Film komplett auf chinesisch drehen will, weil ihm die Arbeit an den japanischen Passagen in “Kill Bill” soviel Spaß gemacht hat.«
trenc am 4. November 2004
Medien |
Mounty hat zwar schon das Wichtigste gesagt, dennoch schreib ich ein paar Zeilen zu dem von Bernd Graff verfassten Artikel über Doom3 in der Süddeutschen Zeitung, da er mir auch aufgefallen ist.
So richtig weiss ich ja nicht, wo genau ich den genannten Artikel einordnen soll; Schubladendenken hin, Schubladenken her. Eine Polemik ist es nicht wirklich, obwohl der Eindruck wegen fehlender oder »verschwurbelter« Argumentation durchaus entstehen kann. Eine wirkliche fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema medialer Wirkung ist es aber auch nicht. Aus selbigem Grund. Sehen wir es als subjektive und leicht konfuse Betrachtung von Doom3 mit verfehlter Wirkung an. Warum verfehlte Wirkung, will ich im folgenden erklären.
Um die semantische Differenzierung der ersten beiden Absätze fortzusetzen, konstatiere ich folgendes: Widerwärtigkeit ist – wie auch Ekel – anerzogen. Wann etwas widerwärtig ist, das entscheidet der Einzelne. Manch einer findet das Verspeisen von Würmern und Insekten widerwärtig, andere leben davon. Folglich ist dieses Spiel nicht für jeden widerwärtig oder zumindest nicht so widerwärtig, dass es deshalb brutal ist. Nicht leugnen kann man allerdings, dass in diesem Spiel brutale Szenen gezeigt werden. So ist der anfangs negierte Umkehrschluss wohl doch richtig: Das Spiel ist (für manch einen) widerwärtig, weil es brutal ist.
Der folgende Schwenk des Autors hin auf die Gewalt im Plot und vor allem auf das Thema einer bewusst vom Spieler vollzogenen Tötung war so vorhersehbar wie es das Spiel nach der ersten halben Stunde wurde. Die nachstehenden Abqualifizierungen der sogenannten »Beschwichtigungsversuche für solche Spiele« werden nur erwähnt und abgetan ohne sich damit auch nur näher zu befassen oder gar zu erläutern.
Besonders bei Netzwerkspielen heißt es dann, dass es gar nicht ums Töten gehe, sondern um den praktizierten Teamgeist. Fast schon obszön: Man meldet gleich Kunstanspruch für solche Spiele an und zitiert etwa Hieronymus Boschs Phantasmagorien oder den obskuren Realismus von David Lynch oder Tarantino, um das digitale Killen auf ein weithin akzeptiertes Werk-Niveau zu hieven.
Der erste Satz dieses Absatzes ist besonders erschreckend. Impliziert er doch in seine Aussage, dass es für den Autor bei Netzwerkspielen doch wirklich nur ums Töten gehe und nicht um einen praktizierten Teamgeist. Wer so etwas schreibt, hat noch nie an einer LAN teilgenommen und disqualifiziert sich überhaupt etwas über Netzwerkspiele schreiben zu dürfen. Jeder setzt seine Prioritäten anders. Aber die Hauptgründe für eine Netzwerksession sind wahrscheinlich folgende: Ein Treffen und vor allem ein Kennenlernen der Leute, von denen man nur deren Avatar (oder Spielfigur) und evtl. noch die Stimme kennt, das Messen (nicht Messern) mit anderen Spielern, gemeinsames Chilli-Essen, Jugendherberge-Feeling und Tausch von Pornos;-).
Und ebenso sind Spiele durchaus mit anderen medialen Werken vergleichbar. Ob es sich bei den zitierten Werken aber auch wirklich jeweils um Kunst handeln muss, liegt im Auge des Betrachters.
Der vermeintliche Zweck der folgenden Zitation der Spieler aus einem nicht näher genannten Spieleforum geht jedoch am Ziel vorbei. Die Zitate belegen doch eindeutig: Es geht nicht mehr um das aktive Töten – das »Killen«:
›Richtig schlecht ist mir geworden bei der Szene, in der man in einen Raum kommt und da so’n Typ an der Decke hängt (am ganzen Körper durchbohrt)! Und das grausamste war, dass der arme Hund noch geröchelt und gequiekt hat.‹
›Habe gerade wieder aufgehört, weil ich mich nicht weiter traute.‹
›Das ganze Spiel ist ein Schreck an sich. Ich zocke nur ein paar Minuten, dann brauche ich ‘ne Pause, um meine Nerven zu erholen. Ich habe keinen Bock mehr. Der Stress wird einfach zuviel. Und Leute, ich bin schon über 30.‹
›das gefühl der hilflosigkeit und der unterlegenheit…ist das, was das spiel ausmacht.‹
Wie beschrieben geht es um die Affekte Furcht, Grusel, Mitleid, Hilflosigkeit und in keinster Weise um das »Killen« – und schon gar nicht von (Pixel-)Menschen. Diese Gefühle sind unter anderem Audruck eines medialen Stilmittels, welches man neudeutsch auch unter dem Namen »suspense« kennt. In fast jedem Hitchcock-Thriller findet man dieses mediale Mittel um Spannung und Grusel zu erzeugen. Geht man von der aristotelischen wirkungsästhetischen Theorie der Katharsis aus, tragen die erregten Affekte Furcht und Mitleid zur Reinigung bei, sprich zur Mäßigung von Gefühlszuständen, wie Affekte und Triebe.
Die Zitation der Spieler greift nicht bzw. wird dem vermuteten Ansinnen des Autors, nicht wirklich gerecht. Der letzte Versuch des Autors das Spiel zu verteufeln zielt auf die allgemeine Wirkung der Medien bzw. Spiele auf ihr Publikum. Eine Studie des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung wird erwähnt. Jedoch werden Titel und Fazit als »verschwurbelt« abgetan. Was daran allerdings »verschwurbelt« sein soll, erschließt sich dem der deutschen Sprache mächtigen nicht.
Titel:›Funktion der Inhalte von Computerspielen für ComputerspielerInnen‹
Das Fazit ist, dass
›von generellen Aussagen oder Wirkungsvermutungen in Hinblick auf Computerspiele nicht mehr ausgegangen werden kann.
Es ist vielmehr so, dass die Bedeutung der Inhalte für die Computerspieler sowohl von den Spielern selbst, als auch von den Spielen und dem Wechselverhältnis zwischen Spiel und Spielern abhängt.‹
Auch wenn der Autor es vermutlich gern anders hätte. Die Aussage der Studie ist klar und sie kommt zu dem eindeutigen Schluss, dass eine Medienwirkung nicht monokausal ist und von der Reziprozität des Konsumenten und des Produktes abhängt. Oder einfach: Die Wirkung ist von Person zu Person unterschiedlich.
Wenn man die speziell zu betrachtende Wirkung von Medien auf Kinder und Heranwachsende außen vor läßt, ist bei einem Wirkungsmodell die Fähigkeit zur Differenzierung von realer und virtueller Welt entscheidend.
trenc am 22. Oktober 2004
Medien |
Der aktuelle SZ-Artikel über Doom3 erinnert irgendwie frappierend an die Diskussionen um die zweifelhaft bis lächerlichen Begründungen des Irak-Krieges vor seinem Beginn bis heute. Deren zweifellos auf die Dauer ermüdendes Herbeten wird von vielen Verteidigern in der Regel mit “Aber,aber,aber….Saddam war böse!” gekontert, einer so richtigen wie für die Diskussion der anderen Zusammenhänge nicht hinreichenden Feststellung. Kontextualisierung, Beschäftigung mit Gegenargumenten oder Unsicherheiten sind auch für SZ-Redakteur Bernd Graff offensichtlich nicht notwendig, denn “Aber,aber,aber…das ist alles so blutig!”. Die gesamte Argumentation reduziert sich auf den wiederholten Verweis auf die Brutalität des in Doom 3 dargestellen Szenarios, wobei, nüchtern betrachtet, gerade die völlig überzogene Menge an Blut und Gore-Anteilen comichaft verzerrend wirkt und vor allem gerade NICHT realistisch ist.
Eine diffenzierte wissenschaftliche Feststellung, die klarstellt, dass einfache Wirkzusammenhänge (virtuelle Gewalt erzeugt reale Gewalt) nicht belegbar sind, wird zwar erwähnt, aber als “verschwurbelt” abqualifiziert. Alles viel zu kompliziert, wo man doch genau sieht, was in dem Spiel geschieht! Die implizite Absicht ist, das wirklich Offensichtliche mit einer gedachten automatischen Wirkung oder Folge zu verbinden. So funktioniert auch der Verweis auf andere menschliche Hautfarben, die sich doch so deutlich sichtbar von der unsrigen unterscheiden und den gedanklichen Schritt, dass es dann doch bestimmt noch mehr Unterschiede gibt, ebenfalls implizieren. Das erinnert mich an meinen Mathematiklehrer, der augenzwinkernd darauf verwies, dass nicht wirklich belegbare Voraussetzungen oder Zusammenhänge von den Wissenschaftlern zur Diskussionsprävention meist mit dem Satzanfang “Wie man leicht sieht, ist…” vorgetragen werden.
Neben einigen sachlichen Fehlern (die aktuellen Verkaufscharts zeigen durchaus keine Dominanz von Ego-Shootern und Kriegssimulationen ist ein Nullbegriff unter dem eben auch Schach rubrizieren kann) fällt wie meistens auch auf, dass der “Sinn” von Doom 3 mangels Hintergrundwissen verborgen bleiben musste. Man sollte es IMO in erster Linie als eine als Hommage zu verstehende Grafikdemo sehen, die für viele Erinnerungen an die “Jugend” mit Doom 1 und Doom 2 hervorruft, den für heutige Verhältnisse unglaublich mies aussehenden Vorgängern, die neben vielen Schrecksekunden auch die ersten Netzwerksessions initiierten und eben als wirkliche Klassiker einzustufen sind. Ganz zu schweigen davon, dass offensichtlich 99,99% derer, die diese Klassiker exzessiv konsumierten, diesen Einfluss viele Jahre ohne Langzeitschäden oder Massenmorde überstanden zu haben scheinen. Es ist abgesehen von seiner Grafik kein besonders herausragendes Spiel, weder typisch noch stilprägend für das Genre und auch die Wirkung der Erschreckens lässt irgendwann nach, weil sie zu leicht vorhersehbar wird. Aber das würde man natürlich erst merken, wenn man tatsächlich selbst längere Zeit spielt und nicht nur seinem Sohn 20 Minuten über die Schulter schaut um danach gleich einen Artikel zu verfassen.
MountainKing am 21. Oktober 2004
Medien | [1]
Eine überaus interessante Erklärung für das Scheitern der eigentlich-nicht-wirklich-aber-irgendwie-dann-zwangsläufig- doch-Nachfolgerin von Harald Schmidt auf Sendeplatz und Format legte Bettina Böttinger in der WELT vor. Die sich selbst durch ihr Äußeres eigentlich mit aller Gewalt von der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht distanzierende Moderatorin hat nun eben dieses als wirklichen Grund für die baldige Absetzung der Show wegen mieser Quoten benannt. Nicht nur, dass es die bösen Kritiker waren, die die Show schlechter schrieben und damit die Zuschauer manipulierten, nein, jene waren auch noch MÄNNER! Und können damit bekanntlich Frauen prinzipiell den Erfolg nicht gönnen oder kämpfen wenigstens verbissen um jede verbleibende Bastion männlicher Dominanz, unter anderem die der Late-Night-Show. Nun haben die Feuilleton-Machos einen wichtigen Sieg errungen, den sie mit einem Bierbesäufnis und Schwanzlängenvergleichen feiern können! Ein billiger Witz? Keineswegs, nur das logische Pendant zu dem, was Frau Böttinger als “weibliche Komik” definiert: “Und wenn eine Pointe mal nicht so ganz ins Schwarze traf, rettete sie sie mit der Erklärung ‘Scheiße, ich bin mitten im Zyklus, nah am Wasser gebaut!’”. Angesichts der Tatsache, dass Männer von allein noch nie auf die Idee gekommen sind, sich über PMS lustig zu machen, ist das vorläufige Ende dieser Spielart des Humors wirklich ein kaum zu verschmerzender Verlust.
Weil Böttinger, die auch weniger in dem Ruf steht, ein großer Schmidt-Fan zu sein, sich hartnäckig weigert, anzuerkennen, dass die auch in dieser Show großartige Parodistin und Komödiantin Engelke auf den anderen für dieses Format eminent wichtigen Gebieten, besonders dem timingsicheren Vortragen der Gags (abgesehen von deren Qualität, die auch sehr schwankte), teilweise und konstant schmerzhafte Fehler unterliefen, zimmert sie an einer für eine eigentlich doch intelligente Frau geradezu hanebüchenen Verschwörungstheorie. Da fällt auch gleich mal unter den Tisch, dass sich vor Schmidt ja bereits Thomas Koschwitz und Gottschalk (beides Männer, soweit bekannt) an vergleichbaren Sendungen versuchten und bei der Kritik wie beim Zuschauer mittelfristig durchfielen. Am Mangel an interessanten Persönlichkeiten und potentiellen Gästen in den Zeiten des Castingwahns, der miesen Laiendarstellerei und öffentlichkeitsgeiler Juristinnen mit rötlichen Betonfrisuren konnte sicher auch Engelke nichts ändern. Vielleicht hätte man mit mehr Zeit auch eine Alternative dazu entwickeln können, wie es Schmidt durch intelligenten Nonsens und Selbstparodie gelang. Es änderte aber wahrscheinlich nichts daran, dass bestimmte Grundvoraussetzungen einfach nicht erfüllt waren und dazu gehörte sicher nicht die Chromosomenpaarung. Aber wenigstens sind Böttingers krampfhaften Versuche, die Abneigung der Kritiker mit Engelkes Einsatz angeblicher spezieller weiblicher Eigenschaften (jugendlich wirkende Tops!) zu erklären, wesentlich lustiger als alle von mir gesehenen Ausgaben der Show.
MountainKing am 12. Oktober 2004
Medien |
(via: GUN-Forum)
trenc am 12. Oktober 2004
Medien | [1]
Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass meine Kritik derart schnell Wirkung zeigen würde, aber nur wenige Stunden nach der Publikation wurde die Sendung erwartungsgemäß eingestellt.
Die offizielle Begründung verweist zwar auf miese Quoten, aber alle Leser dieses Blogs kennen die wahren Hintergründe. :)
Mal schauen, ob es auch beim Musikantenstadl wirkt…immerhin konnte man da zuletzt die DJ Ötzi-Version (ist wirklich nur Zufall, dass der nun zweimal hintereinander auftaucht!) des “Holzmichl”-Liedes vernehmen. Und irgendwo muss auch der Thrash mal eine Grenze haben.
MountainKing am 29. September 2004
Medien |
John de Mol sucht für seine TV-Firma einen Creative Director. Nach so vielen Jahren im Geschäft kommt das nun doch reichlich spät, möchte man meinen. Soll das etwa heißen, die Zukunft von endemol bestünde nicht mehr im Recyclen von im Ausland entdeckten Formaten für den deutschen Markt und der damit verbundenen Etablierung diverser intellektueller Wracks als Pseudostars? Wäre das -natürlich ebenfalls importierte- Hire or Fire also eine Art Fanal, nach dem plötzlich die Kreativität im deutschen TV-Business ausbrechen würde? Diese Gefahr besteht wahrscheinlich kaum, wenn die angeblich aus Tausenden ausgewählten 10 Kandidaten tatsächlich die Besten auf ihrem Gebiet sein sollen. Vielmehr handelt es sich um eine Art Yuppie-Big-Brother, stilecht im Loft stattfindend und mit den üblichen Zutaten versehen. Mehr als Kompetenz zählt, dass die Kandidaten gegensätzliche Charaktere darstellen (sollen), um so Konflikte zu forcieren, die natürlich durch die bei der Vergabe des besten Jobs der Welt (bei 300 000 Euro Jahresverdienst mit Dienstwagen und Assistent durch die Gegend kutschieren, während im Keller 20 Soziologie-Studenten mit geröteten Augen ausländische Sender nach verwertbarem Material durchforsten) notwendigen "Challenges" sowieso entstehen sollen.
Die wichtigste Gemeinsamkeit aller Teilnehmer besteht darin, dass sie bei jedem zweiten Satz betonen müssen, sie wären die perfekte Wahl für diesen Posten. Ansonsten trifft der nette farbige Quoten-Ossi auf den Sprößling der Volksmusik-Terroristen Judith und Mel, die alle Kunden ukrainischer Mädchenhändlerringe optisch sicher befriedigende Osteuropäerin und den sich als besonders arrogantes Arschloch zu verkaufen suchenden Glatzkopf. Der rassige Italiener und die den IQ einer Scheibe Gouda kaum erreichende, aber in einem kurzen Abendkleid sicher lecker aussehende Landsmännin von DJ-Ötzi runden mit einer sich als kamerageile Bilderbuch-Zicke gebärdenden Blondine das Bild der sich natürlich allein durch ihre überragenden Fähigkeiten Qualifizierten stilecht ab.
Grundvoraussetzung für die Einstellung bei endemol ist offenbar, dass man nicht schlauer als der mit einem holländischen Realschulabschluss gesegnete Chef und auch nicht wesentlich witziger sein darf. Das sind natürlich für einen Großteil der Bewerber nur schwer zu nehmende Hürden. Es könnte ja unter ihnen jemand sein, der nicht die ewige Variation des BB-Konzeptes als einzig akzeptables Showformat ansieht. Oder gar auf reißerische Erzeugung von Emotionen inklusive Closeups auf die Gesichter der gleich von der Jury kritisierten Teilnehmer und die Inszenierung des Abgangs durch wimmernde Geigen, die dem Ganzen einen Hauch Tragik verleihen und kaschieren sollen, dass der Betreffende eher froh sein sollte, diesem Schwachsinn entkommen zu sein, verzichten wollte. Apropos Jury, auch hier macht sich natürlich geballte Kompetenz breit. Wer sollte über die Zukunft der TV-Unterhaltung auch besser befinden können als der Manager von Verona Feldbusch und das Dschungelfossil Caroline Beil, die immerhin im Gegensatz zu ihren beiden Kollegen mehrere deutsche Sätze hintereinander unfallfrei fomulieren kann. So sieht also eine Schnellschuss-Eindeutschung der in Amerika sehr erfolgreichen Show "The Apprentice" aus, bei der Donald Trump ebenfalls diverse Bewerber auf Tauglichkeit (wofür auch immer) testete. Bevor bei RTL die offizielle Version mit Reiner Calmund anläuft, musste daher Pro7 fix einige Wochen vorher die Kopie der Kopie auf die Bildschirme bringen. Der Traumjob des Creative Director erschöpft sich demnach offenbar darin, schneller als die Konkurrenz ein nachgemachtes Konzept auf noch niedrigerem Niveau und mit schlechteren Knallchargen besetzt auf die TV-Zuschauer loszulassen.
MountainKing am 28. September 2004
Medien |